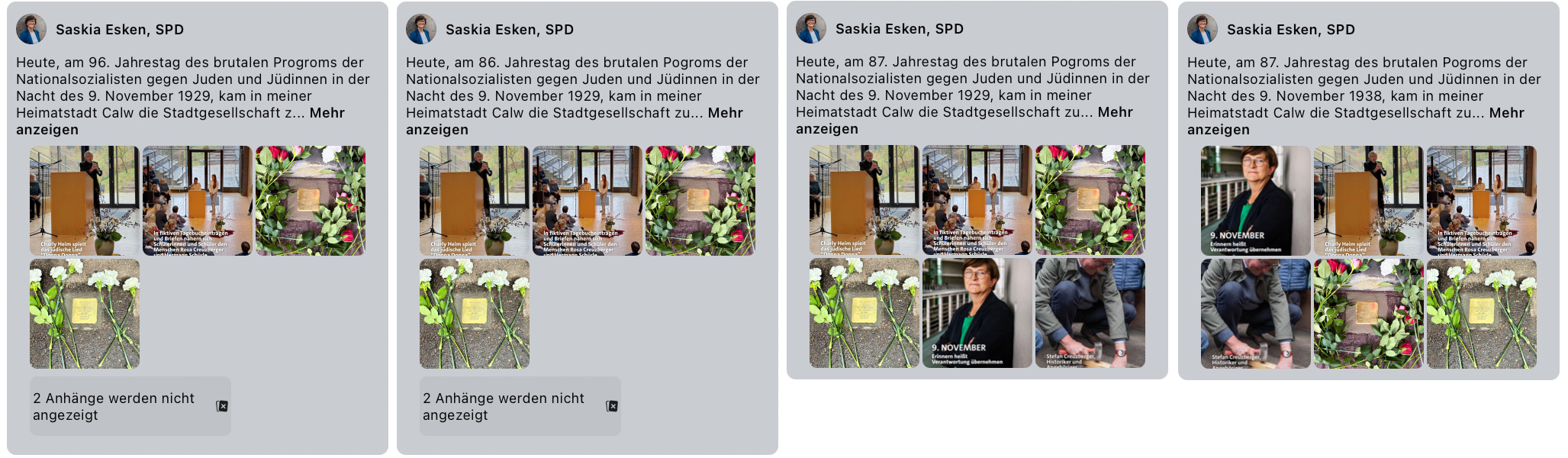Es ist wieder soweit: 9. November – der Tag, an dem die Deutschen überhaupt nicht mehr wissen, was sie denn nun feiern wollen oder betrauern sollen. Und aus dem bürgerlichen Feuilleton dräut es daher und raunt einem dunkel-mystisch entgegen: Ein deutscher Schicksalstag sei der 9. November. Unter Schicksal – sei es nun mit unbestimmtem oder bestimmtem Artikel – hat man es in diesem Land noch nie gemacht.
Eine Zeit lang sah es ja so aus, als würde im Wettstreit darum, welcher der zahlreichen schicksalhaften 9. November denn nun der schicksalhafteste ist, der 9. November 1989 als Sieger hervorgehen. Doch 36 Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR und ca. drei Billionen Euro Transferleistungen für den „Aufbau Ost“ hat da niemand mehr Bock drauf – die Deutschen im Westen nicht, und die im Osten schon mal gar nicht. Dass Kapitalismus nicht nur preisgünstige Südfrüchte, sondern auch Arbeitslosigkeit und höhere Mieten bedeutet, hätten sie zwar wissen können, aber in bester deutscher Tradition spielt man gerne das arme, weil arglose Opfer.
Immer schon chancenlos war der 9. November 1918 – der 9. November, an dem Philipp Scheidemann (SPD) vom Balkon des Reichstags die deutsche Republik ausgerufen hatte. Denn dieses Datum ist dann doch einfach zu eng verknüpft mit dem Ende eben dieser Republik am 30. Januar 1933 – und mit der Frage, wie es dazu kommen konnte, und dem, was dann folgte: die nationalsozialistische Diktatur, der von Deutschland begonnene Zweite Weltkrieg und – last but not least – jenes Verbrechen, für das die Deutschen bis heute kein deutsches Wort gefunden haben, obwohl es in dieser Form nur in Deutschland vollzogen werden konnte: der erste (und bislang einzige) staatlich bis ins Detail organisierte und industriell umgesetzte Völkermord der bekannten menschlichen Geschichte – der Holocaust, die Vernichtung der europäischen Juden.
Es mag daher überraschen, dass nun ausgerechnet jener 9. November 1938, dem man fälschlicherweise nachsagt, er habe den Beginn der systematischen Verfolgung der Juden durch die Deutschen markiert, mittlerweile quasi zum liebsten 9. November der Deutschen geworden ist. Doch das hat ganz einfache Gründe.
Zum einen: Sowohl Täter als auch Opfer sind – von den wenigen Ausnahmen abgesehen, die man mittlerweile an einer Hand abzählen kann – tot. Man muss nicht fürchten, sich mit Einwänden der einen oder Kritik der anderen Seite herumschlagen zu müssen.
Auch wenn die Geschichte der Verfolgung der Juden in Deutschland (und später Europa) nach dem 9. November 1938 noch weiterging und schließlich in den Gaskammern der Vernichtungslager ihren furchtbaren und in keiner Sprache der Welt zu beschreibenden Endpunkt fand, erspart einem der 9. November 1938 – so paradox dies auch sein mag – genau dies: den Blick auf die Vernichtungslager, die Gaskammern und Krematorien.
Die Schuld lässt sich so auf ein handhabbares Format reduzieren. Wie der Verbrecher vor Gericht, der freimütig, reuevoll und tränenreich seine kleineren Straftaten gesteht, um so von seinem eigentlichen Verbrechen abzulenken.
Und so kam es – anders, als von vielen erwartet (oder auch befürchtet) –, dass von all den angeblich so schicksalhaften Tagen des letzten Jahrhunderts, die auf den 9. November fielen, ausgerechnet der 9. November 1938 zum „Liebling“ der Deutschen wurde.
Man schlägt sich an die Brust, bekennt sich – mitunter tränenreich – zur historischen Schuld, zu den Verbrechen, die wahlweise im deutschen Namen oder vom deutschen Boden aus begangen wurden (als ob Namen und Boden, und nicht Menschen, Verbrechen begehen), lobt sich selbst für die eigene Erinnerungskultur (wobei man gerne den mühsamen und oft furchtbaren Kampf um dieses Erinnern unterschlägt), empfiehlt diese dann – voll gedankenloser Arroganz – als Lehrbeispiel Dritten (als ob Auschwitz eine Art Praktikum für die eigene Menschwerdung gewesen wäre: irgendwie schlimm, aber letztlich notwendig), ruft „Nie wieder!“ – und hält der Welt mit aggressivem Gestus das Bild des wiedergutgewordenen Deutschen ungefragt unter die Nase.
Doch die Tränen, die bei solchen Gelegenheiten zu vergießen sich deutsche Politiker angewöhnt haben, sind die Tränen des unverbesserlichen, manipulativen Narzissten – unfähig zur Auseinandersetzung mit Kritik, stets das eigentliche Opfer seiner eigenen Verbrechen und Schandtaten.
Es sind die Tränen des Krokodils.